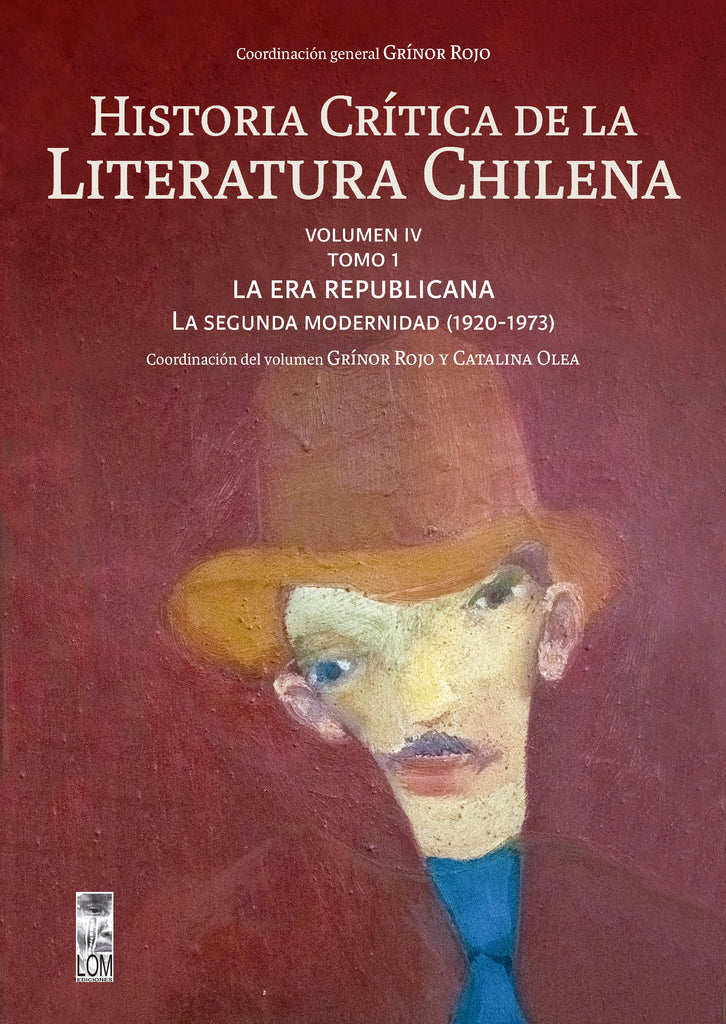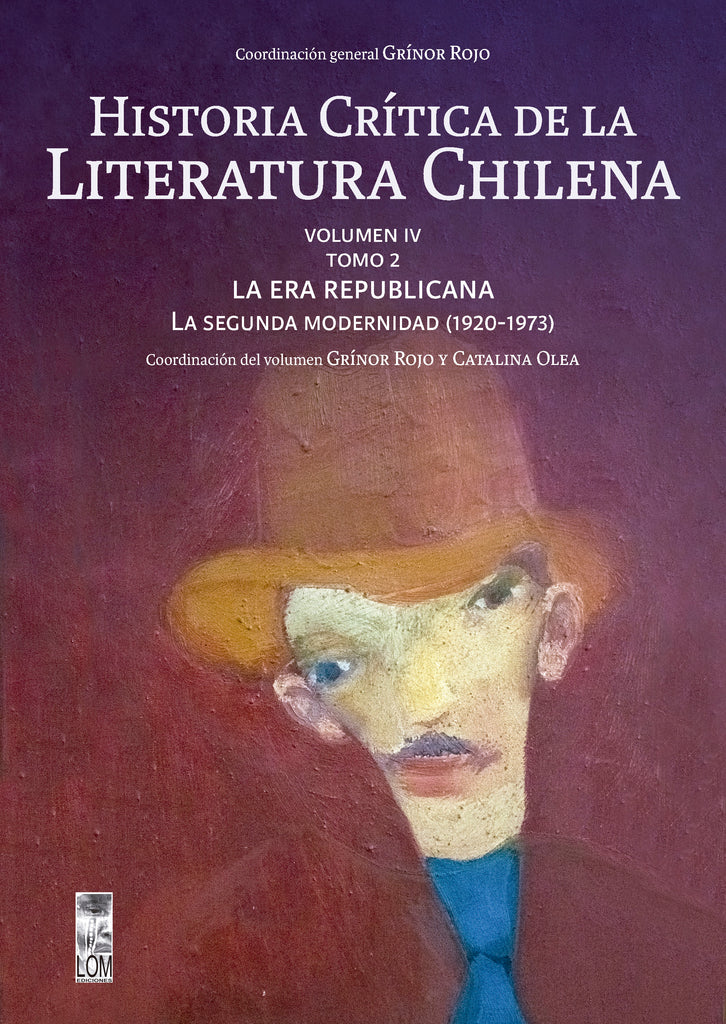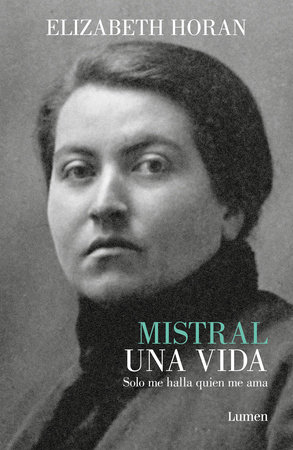Pilar, eine Frau, die gerade Mutter geworden ist, entdeckt, dass sie adoptiert wurde. Was stabil und solide schien – eine Familie, ein Job, das Leben selbst – beginnt zu zerfallen. Der Kauf eines Hauses mit Swimmingpool verschafft Patri zwar eine gewisse Ruhe, doch bald erfährt sie, dass neben ihrem neuen Zuhause eines der dunkelsten geheimen Gefangenenlager der letzten Militärdiktatur in Argentinien betrieben wurde: der Pozo de Quilmes. Ist sie die Tochter von Verschwundenen? Ist sie die Tochter eines Militärs? Eines Unterdrückers?
Dieses Ereignis löst eine Reihe von Fragen über ihre Identität und die Möglichkeit aus, Tochter von verschwundenen Häftlingen zu sein. Dies führt sie zu Menschen und Geschichten aller Art: eine linksgerichtete Mitstreiterin aus der Sekundarschule, launische und leugnende Nachbarinnen, eine englische Familie im ständigen Niedergang, in einem Viertel, das von Rätseln umgeben ist. Außerdem wird Patri, die Protagonistin, inmitten des Wirbelsturms in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, die ihr verspricht, ihr das zu geben, was sie verloren und immer gesucht hat: ihre Identität.
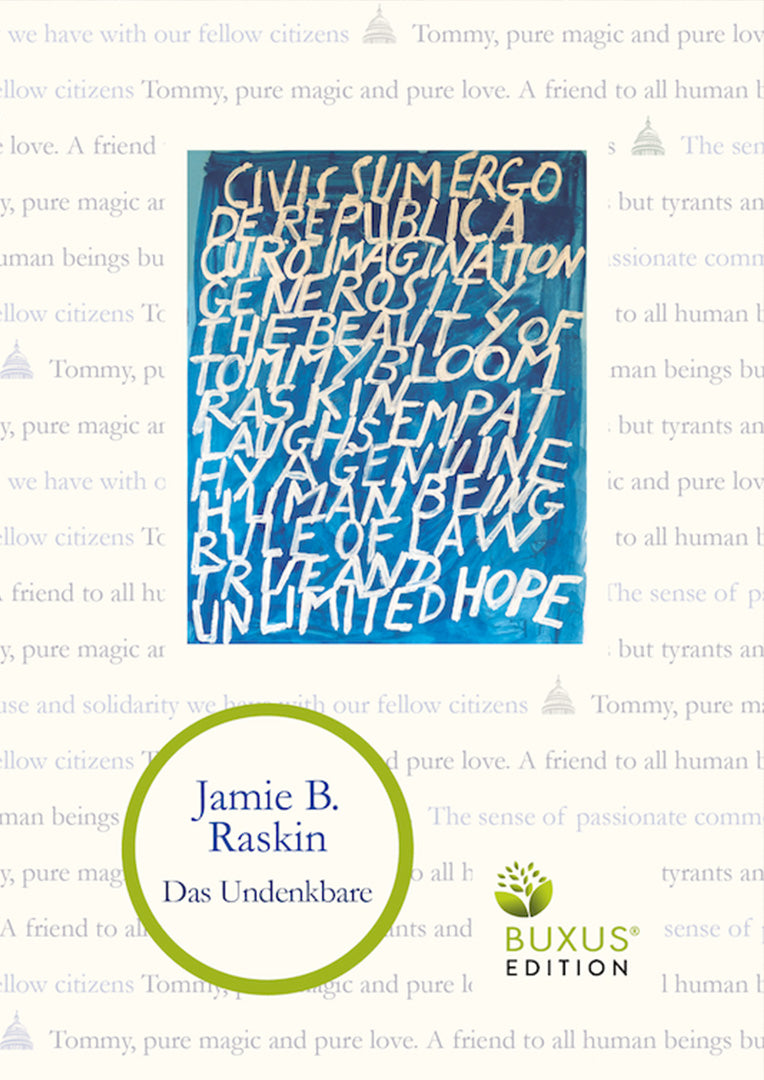


 Der 18. Oktober 2019 hat eine Flut von Büchern hervorgebracht, von denen einige Texte es geschafft haben, einen Teil dieser Zeit zu definieren, als das Land Chile praktisch in Flammen stand. Von Chronisten bis zu Historikern, Philosophen und Romanautoren bieten sie unterschiedliche und manchmal auch gegensätzliche Ansichten.
Der 18. Oktober 2019 hat eine Flut von Büchern hervorgebracht, von denen einige Texte es geschafft haben, einen Teil dieser Zeit zu definieren, als das Land Chile praktisch in Flammen stand. Von Chronisten bis zu Historikern, Philosophen und Romanautoren bieten sie unterschiedliche und manchmal auch gegensätzliche Ansichten.